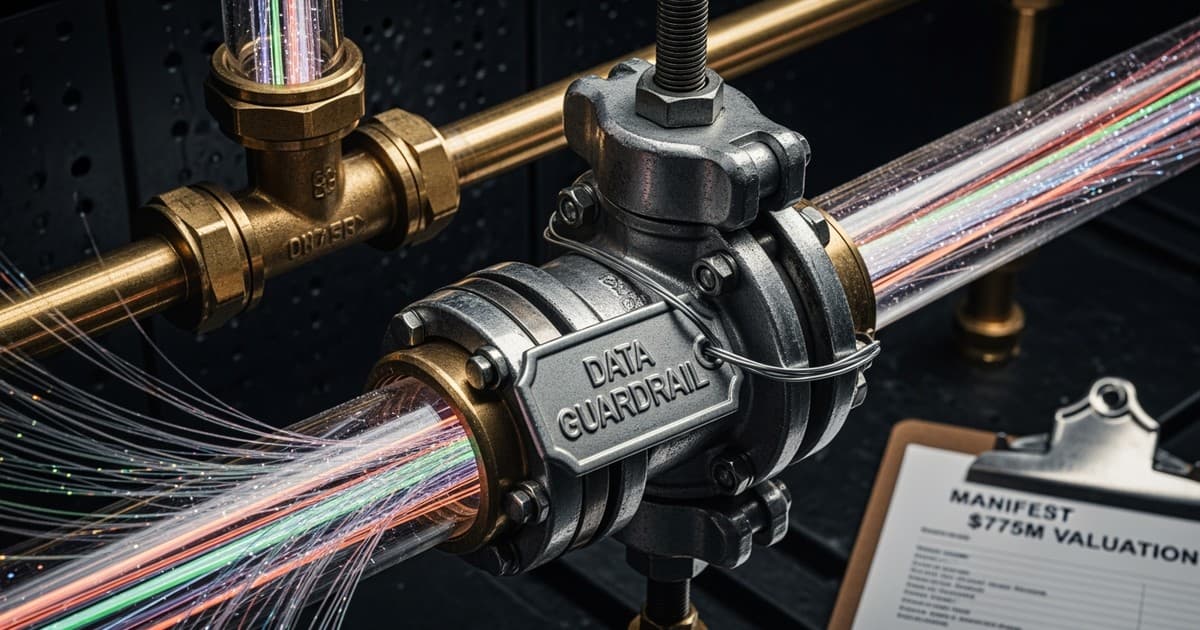GEMA verklagt Suno wegen 500 Mio. USD: KI-Musik steht vor Urheberrechts-Abrechnung

Von Trevor Loucks
Gründer & Leitender Entwickler, Dynamoi
Deutschlands GEMA hat am 21. Januar eine wegweisende Urheberrechtsklage gegen die mit 500 Mio. USD bewertete KI-Musikplattform Suno eingereicht. Sie wirft dem Unternehmen vor, systematisch urheberrechtlich geschützte Songs für das Training seiner KI ohne Lizenzen oder Zahlungen an die Urheber verwendet zu haben.
Warum es wichtig ist:
Dies stellt die erste europäische juristische Anfechtung gegen einen führenden KI-Musikgenerator dar und prüft, ob Plattformen urheberrechtlich geschützte Musik frei für Trainingsdaten verwenden dürfen.
Strategische Implikationen: Der Fall könnte einen Präzedenzfall für Lizenzanforderungen für KI in ganz Europa schaffen, wo das Urheberrecht sich erheblich von den US-amerikanischen „Fair Use“-Schutzbestimmungen unterscheidet.
Ausmaß der Gefährdung: Die GEMA vertritt 95.000 deutsche Urheber sowie über 2 Mio. Rechteinhaber weltweit, was der Klage eine massive Branchenunterstützung verleiht.
In Zahlen:
- 500 Mio. USD: Die aktuelle Bewertung von Suno trotz wachsender rechtlicher Herausforderungen
- 95.000: GEMA-Mitglieder, deren Werke angeblich ohne Erlaubnis verwendet wurden
- 5 große Künstler: Speziell wegen KI-„Plagiats“ genannt, darunter Alphaville, Lou Bega, Modern Talking
- 21. Januar: Datum der Klageeinreichung beim Landgericht München
Zwischen den Zeilen:
GEMA veröffentlichte Audiovergleiche, die zeigen, wie Sunos KI Titel erzeugt, die „verwechselbar ähnlich“ zu ikonischen Songs wie Forever Young und Daddy Cool sind. Die Beweise deuten auf systematische Urheberrechtsverletzungen statt auf zufällige Ähnlichkeiten hin.
Das Problem der Trainingsdaten: Im Gegensatz zur Klage der großen Labels in den USA, die sich auf Aufnahmerechte konzentriert, zielt die GEMA auf Song-Urheberrechte ab – was möglicherweise leichter zu beweisen und teurer zu verteidigen ist.
Europäischer Vorteil: Das EU-Urheberrecht verlangt eine „faire Vergütung“ für KI-Training, im Gegensatz zur US-amerikanischen Fair-Use-Doktrin, die KI-Unternehmen typischerweise anführen.
Konflikt bei der Plattform-Monetarisierung
Suno verlangt Abonnementgebühren für die Premium-KI-Musikgenerierung, während die Urheber nichts für ihre in das Training einfließenden Werke erhalten. Die GEMA argumentiert, dass dies einen direkten wirtschaftlichen Schaden verursacht, da KI-generierte Inhalte mit von Menschen geschaffener Musik konkurrieren.
Realitätscheck:
Suno weicht nicht zurück. Das Unternehmen wies die Klage der großen Labels bereits zurück und wird sich wahrscheinlich auch gegen die Ansprüche der GEMA wehren. Europäische Gerichte haben jedoch historisch gesehen die Rechte der Urheber gegenüber der Technologieinnovation bevorzugt.
Risiko für Präzedenzfälle: Ein Sieg der GEMA könnte ähnliche Klagen in ganz Europa auslösen und die Wirtschaftlichkeit der KI-Musik grundlegend verändern.
Vergleichsdruck: Da nun Klagen sowohl in den USA als auch in Europa anhängig sind, sieht sich Suno steigenden Rechtskosten gegenüber, die es zu Lizenzverhandlungen zwingen könnten.
Was kommt als Nächstes:
Unmittelbare Auswirkungen auf die Branche
Plattenlabels und Verlage weltweit beobachten diesen Fall genau. Ein GEMA-Sieg würde eine juristische Blaupause für ähnliche Maßnahmen gegen andere KI-Musikplattformen liefern.
Strategien zur Reaktion der Plattformen
KI-Musikunternehmen müssen sich möglicherweise von „alles scrapen“-Modellen hin zu lizenzierten Trainingsdatensätzen bewegen – was die Kosten drastisch erhöht, aber das Rechtsrisiko verringert.
Stärkung der Urheber
Ein Erfolg könnte das Recht der Urheber festschreiben, sich vom KI-Training auszuschließen und eine Vergütung zu fordern, was die gesamte Landschaft der generativen KI neu gestalten würde.
Das Fazit:
Die Klage der GEMA stellt eine grundlegende Herausforderung für das Geschäftsmodell der KI-Musikindustrie dar. Im Gegensatz zu den US-amerikanischen Fair-Use-Argumenten bietet das europäische Urheberrecht stärkere Schutzbestimmungen für Urheber, die Plattformen zwingen könnten, für Trainingsdaten zu bezahlen.
Für Führungskräfte der Musikindustrie: Beobachten Sie diesen Fall genau – das Ergebnis wird bestimmen, ob KI-Plattformen weiterhin urheberrechtlich geschützte Werke ohne Erlaubnis nutzen können oder ob sie teure Lizenzvereinbarungen aushandeln müssen, was die Ökonomie der KI-Musikgenerierung neu gestalten könnte.
Über den Redakteur

Trevor Loucks ist der Gründer und leitende Entwickler von Dynamoi, wo er sich auf die Konvergenz von Musikgeschäftsstrategie und Werbetechnologie konzentriert. Er konzentriert sich darauf, die neuesten Ad-Tech-Techniken auf Kampagnen von Künstlern und Plattenlabels anzuwenden, damit diese das nachgelagerte Wachstum der Musiklizenzeinnahmen steigern.